It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?
Blick nach Süden
Literarische Italienbilder aus der deutschsprachigen Schweiz
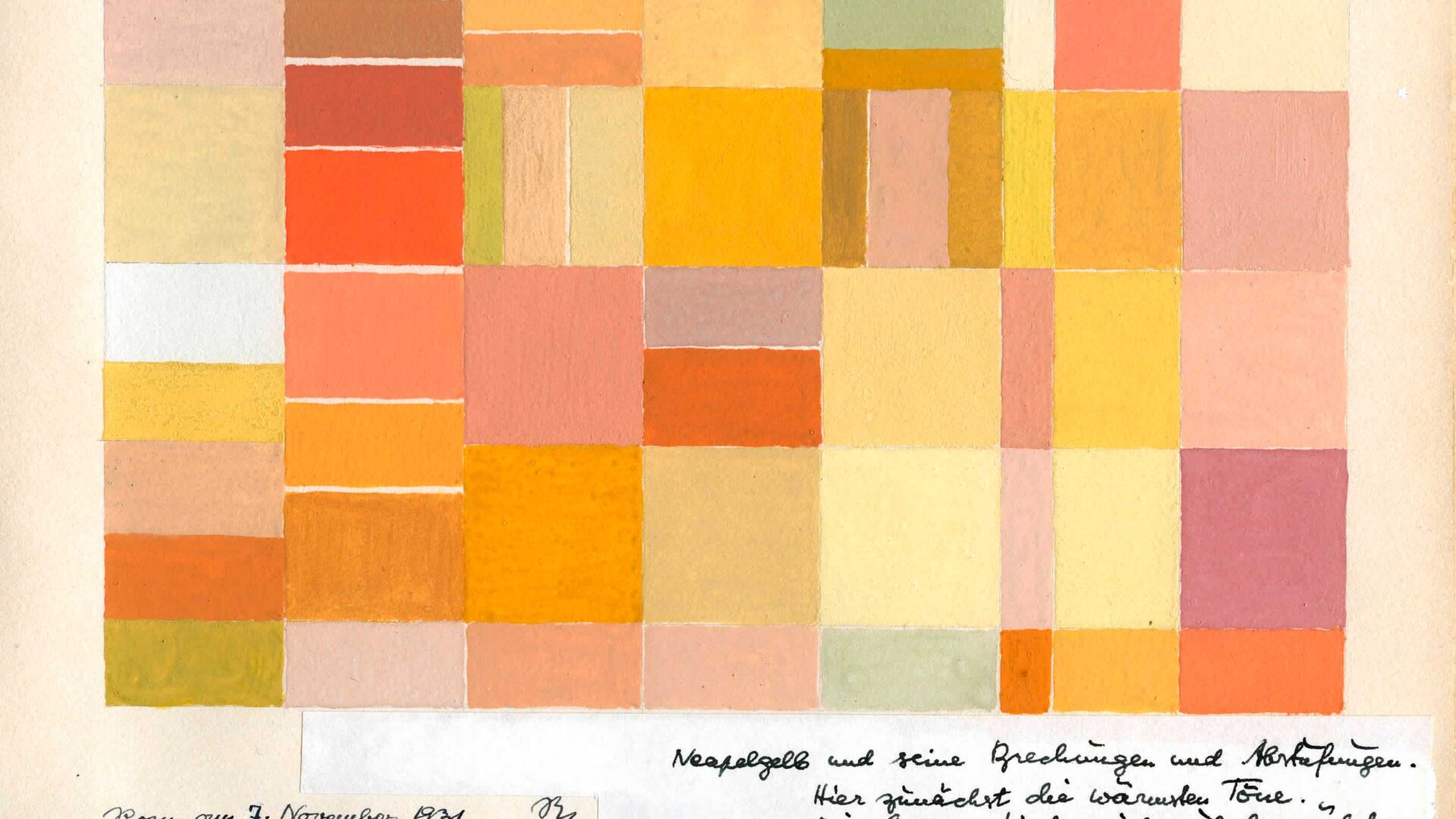
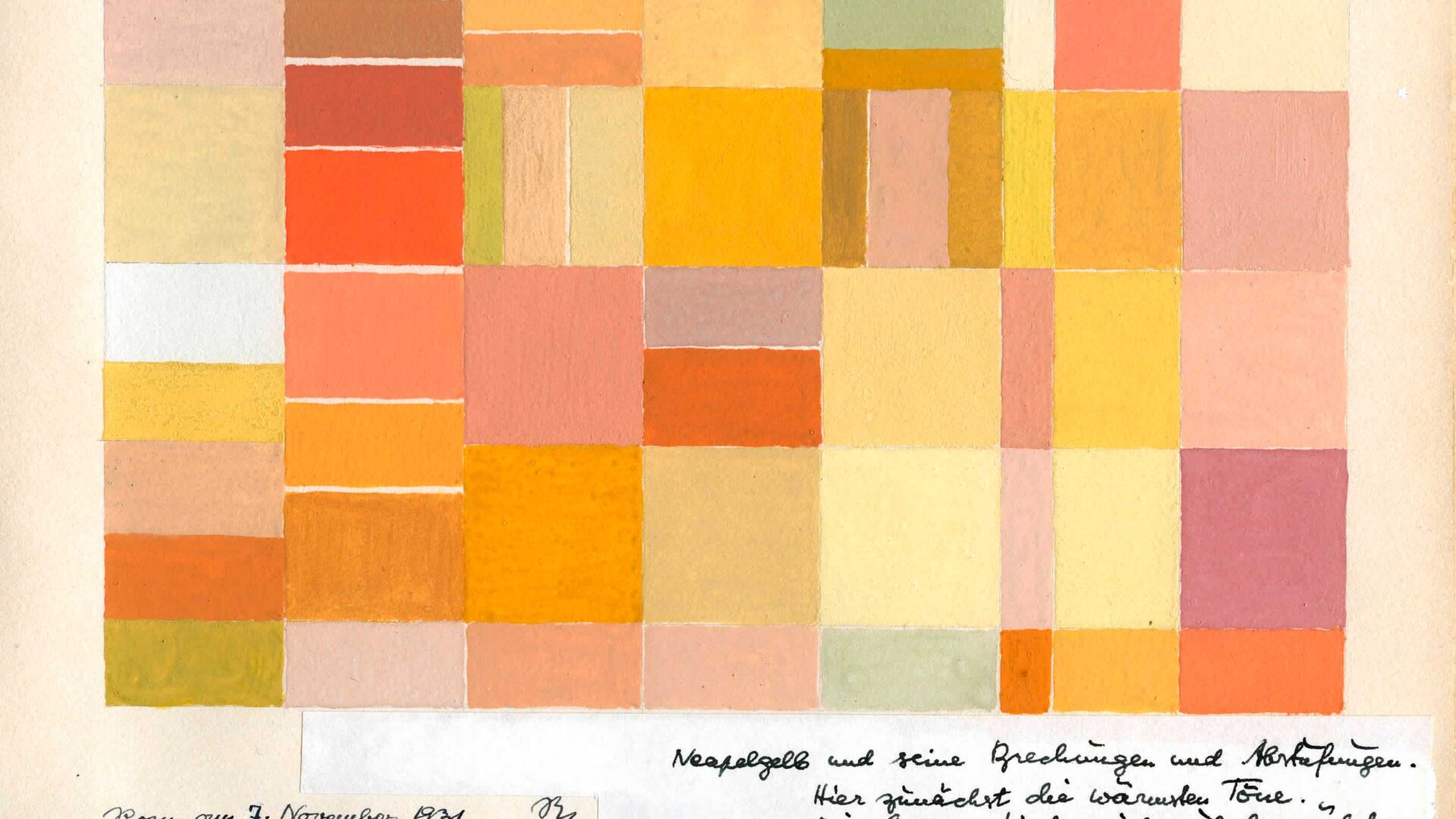
It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?